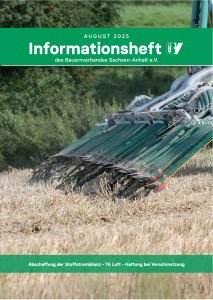Liebe Berufskolleginnen und -kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt ist leistungsfähig, anpassungsbereit und voller Fachwissen. Unsere Betriebe beweisen Tag für Tag, wie viel Innovationskraft und Verantwortungsbewusstsein im Ackerbau steckt. Ob Bodenbearbeitung, Sortenwahl oder Pflanzenschutz – wir entwickeln unsere Arbeitsweisen stetig weiter und reagieren auf neue Herausforderungen. Die Betriebe investieren in moderne Technik, überdenken und verbessern ihre Fruchtfolgen, nutzen digitale Systeme und erproben neue Verfahren. Das ist echte Zukunftsarbeit.
Wer auch morgen noch erfolgreich und nachhaltig wirtschaften soll, darf nicht nur mit den Möglichkeiten von gestern arbeiten. Wir Landwirtinnen und Landwirte brauchen moderne Sorten, angepasste Anbausysteme und größere Handlungsspielräume, vor allem bei der Düngung und im Pflanzenschutz. Denn die Anforderungen an den Pflanzenbau wachsen weiter. Die Folgen des Klimawandels sind auf dem Acker längst spürbar. Extreme Wetterlagen, längere Trockenperioden, aber auch neue Schaderreger und Krankheiten fordern uns jedes Jahr aufs Neue. Hinzu kommen gesellschaftliche Erwartungen, politische Zielvorgaben und der große wirtschaftliche Druck, der auf unseren Betrieben lastet. Der Ackerbau der Zukunft wird komplexer – und wir brauchen die passenden Werkzeuge, um ihn erfolgreich gestalten zu können.
Die Sortenwahl spielt dabei eine zentrale Rolle. Moderne, resiliente Sorten sind ein Schlüsselfaktor, um klimatische Risiken abzumildern. Wir brauchen Sorten, die mit weniger Dünger und Pflanzenschutzmitteln auskommen und trotzdem die Erträge absichern. Deshalb ist es entscheidend, dass die Pflanzenzüchtung vorankommt. Innovationen wie CRISPR/Cas bieten große Chancen für einen nachhaltigen Pflanzenbau, in Deutschland und weltweit. Diese Potenziale dürfen wir nicht aus politischen oder ideologischen Gründen ungenutzt lassen, eine gesellschaftliche Diskussion ist richtig, muss aber ehrlich geführt werden. Dazu zählt, dass die Züchtung neuer und besserer Sorten für die Versorgungssicherheit sehr wichtig ist und auch weiterhin sein wird.
Gleichzeitig brauchen wir zeitgemäße Anbauverfahren, die sich flexibel an unterschiedliche Standortbedingungen und Witterungsverläufe anpassen lassen. Technische Hilfsmittel wie Sensorik und Drohnen, teilflächenspezifische Bewirtschaftung oder konservierende Bodenbearbeitung sind längst in allen Bereichen angekommen. Aber ihre Einführung scheitert zu oft an finanziellen Hürden oder mangelnder Unterstützung. Wer von uns eine nachhaltige Bewirtschaftung verlangt, muss uns auch die Mittel an die Hand geben, sie umzusetzen. Dazu zählt nicht nur die Investitionsmöglichkeit durch den Betrieb, ebenso braucht es eine breite Netzabdeckung und bürokratiearme Anwendung.
Ein besonders kritischer Punkt bleibt der Pflanzenschutz. Die Zahl verfügbarer Wirkstoffe für den Ackerbau sinkt, ohne dass gleichwertige Alternativen zur Verfügung stehen. Wir als Berufsstand haben ein großes Interesse daran, den Mitteleinsatz zu reduzieren und gezielter vorzugehen. Doch das erfordert mehr als Appelle: Es braucht verlässliche Zulassungsverfahren, mehr Forschung an biologischen Verfahren, moderne Technik zur präzisen Ausbringung und vor allem die politische Bereitschaft, praktikable Lösungen zuzulassen. Ein wirksamer Pflanzenschutz ist keine Komfortfrage, sondern eine Grundvoraussetzung für stabile Ernten und wirtschaftliche Sicherheit.
Unsere Betriebe leisten bereits heute einen Balanceakt zwischen Ökonomie, Ökologie und gesellschaftlichen Erwartungen. Viele tun das mit großer Sorgfalt, Offenheit und Innovationsfreude. Aber diese Haltung darf nicht ins Leere laufen. Zukunft entsteht dort, wo Gestaltungsspielräume vorhanden sind. Und genau dafür setzen wir uns als Bauernverband ein. Denn klar ist: Gute Ernten und gesunde Böden, stabile Betriebe und wettbewerbsfähige Strukturen – all das geht nur mit einer Landwirtschaft, die gestalten kann. Nicht mit Rückschritten, sondern mit Fortschritt.
Ihr
Sven Borchert
1. Vizepräsident
Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V.
Blick ins Heft:
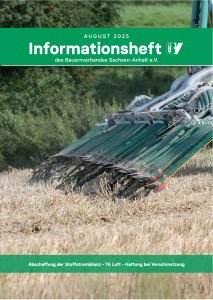

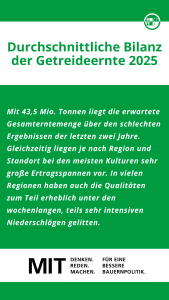
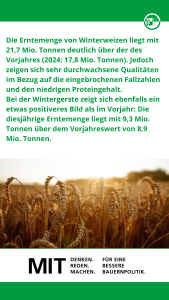

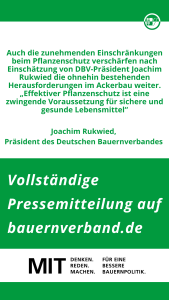

 Maehdrescher_Quelle_DBV-Brauer
Maehdrescher_Quelle_DBV-Brauer