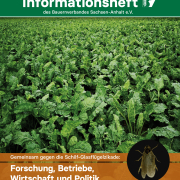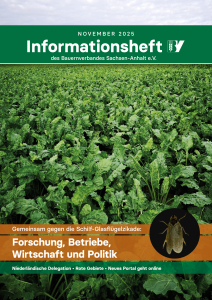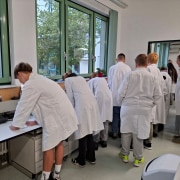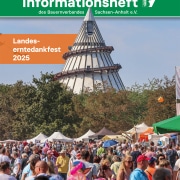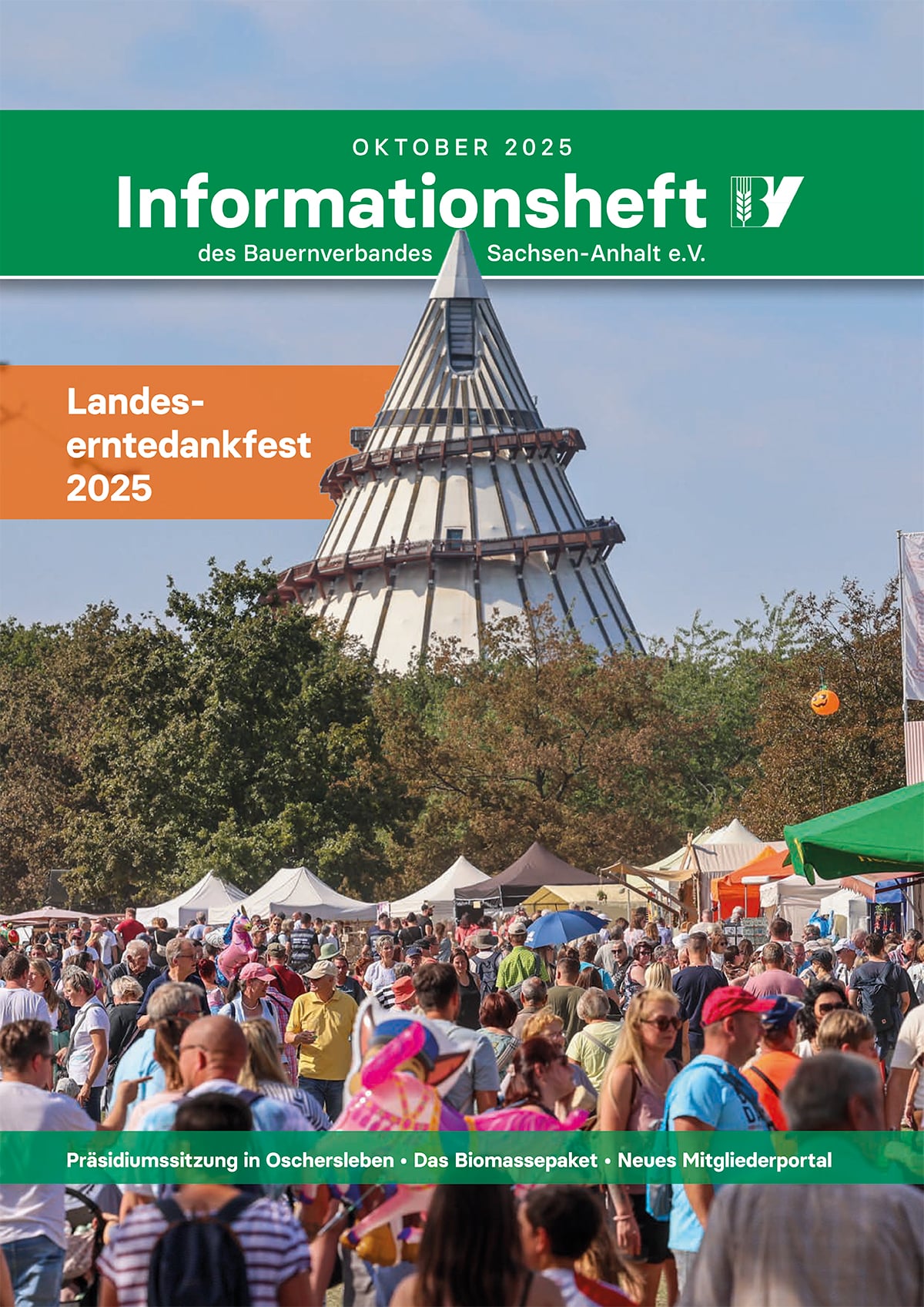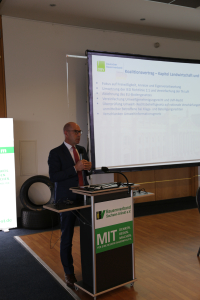November-Kommentar im Informationsheft
Werte Mitglieder,
werte Leserinnen und Leser,
die neue EU-Kommission ist seit fast einem Jahr im Amt und hat in einer Zeit der weltweiten Krisen eine sehr verantwortungsvolle politische Aufgabe: den Kontinent politisch zusammenzuhalten. Die Idee eines starken Europas, das für Frieden steht und eine Zukunft, die gemeinsam in Freiheit und Wohlstand gestaltet wird, ist trotz aller Krisen nicht obsolet.
Die Europäische Union steht im Herbst 2025 innenpolitisch- und außenpolitisch vor einer Vielzahl komplexer Spannungsfelder. Nicht zuletzt hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deutlich gemacht, dass Europa seine strategische Autonomie stärken und sich auf eine neue Weltordnung einstellen muss, die zunehmend von Machtpolitik geprägt ist.
Außenpolitisch bleibt die Lage angespannt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die instabile Lage im Nahen Osten und die Politik Donald Trumps nötigen die EU förmlich zu einer selbstbewussteren Außenpolitik. Die Unterstützung der Ukraine in finanzieller, militärischer und humanitärer Hinsicht ist nur ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der EU als globaler Akteur. Auch die EU-Erweiterung rückt verstärkt in den Fokus. Die Kommission will mit einem neuen Erweiterungspaket die vorhandenen Beitrittsprozesse beschleunigen, als geopolitisches Signal, das Stabilität und demokratische Werte in Europas Nachbarschaft fördern soll.
Innenpolitisch kämpft die EU mit der Reform ihrer Institutionen und Gesetzeswerke. Die geplanten Vereinfachungen durch sogenannte „Omnibus-Pakete“ sollen Bürokratie abbauen, während Initiativen zur Digitalisierung, KI-Entwicklung und Energieunabhängigkeit die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollen.
Zentral ist neben diesen Politikfeldern die künftige finanzielle und inhaltliche Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik. Die weitreichenden Vorschläge zur GAP ab 2028 haben bei ihrer Veröffentlichung im Juli umgehend Widerstand auf vielen Ebenen hervorgerufen und zu ersten kleinen und zaghaften Reaktionen des Zurückweichens geführt. Vieles der Vorschläge ist immer noch im Ungefähren und bedarf einer intensiven Bewertung und Begleitung. Konstatieren darf man aber heute schon, dass die EU-Kommission einen grundlegenden Umbau von EU-Haushalt und GAP-Struktur vornehmen will. Da ab der nächsten Förderperiode auch der Schuldendienst aus den Corona-Jahren eingepreist wird, sorgt dies in Summe für einen Anstieg der Mittel im Mehrjährigen Finanzrahmen auf 1,15% des Bruttonationalprodukts plus der Tilgungen in Höhe von 0,11% auf dann 1,26% des BNE. Alleine daran wird sich zeigen, was die Mitgliedstaaten bereit sind zu tragen. Aus landwirtschaftlicher Sicht sollten wir dafür sein, dass mehr Geld nach Brüssel fließt, denn sonst wird unser Anteil am Gesamttopf sicher noch geringer.
Das wir als Branche so dagegenhalten hat nicht zuletzt mit den Unsicherheiten auf den Betrieben zu tun. Wir merken seit Jahren, dass die Kostenstrukturen nur in eine Richtung laufen und das auf der Gegenseite die Erlöse nicht mithalten können. Speziell der Ackerbau hat derzeit erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen und nicht selten Liquiditätsprobleme. Die Phantasie für höhere und kostendeckende Preise fehlt und deshalb ist die Grundabsicherung über die GAP so fundamental wichtig. Die Eigenverantwortung der EU-Kommission muss dazu führen, anzuerkennen, dass wir nicht immer mehr politischen externen und internen Druck durch gewünschte, aber nicht erforderliche Regelungen auf den Sektor ausüben dürfen, und gleichzeitig noch die finanzielle Unterstützung herunterfahren.
Es fehlt derzeit mehr als an einer realistischen Expertise und Einschätzung, wo sich die Landwirtschaft politisch hin entwickeln soll. Mit den aktuellen Tendenzen und Ausrichtungen werden die Konzentrationsprozesse und der Strukturwandel weitere Fahrt aufnehmen. Es mag sein, dass man erkannt hat, dass in der EU junge Landwirte fehlen und diese stärker finanziell über die neue GAP unterstützt werden müssen. Das aber kann es nicht alleine sein, denn die langfristigen finanziellen Perspektiven aus Markterlösen und guten Rahmenbedingungen auf den Betrieben müssen vorhanden sein. Wir können weder preislich mit Getreide aus der Ukraine konkurrieren noch dürfen wir uns am Konsumenten vorbei entwickeln.
Es hat immer diffizile Zeiten mit hoher Unsicherheit gegeben, nur gerade deshalb muss die EU nun Sicherheit produzieren und erkennen lassen, dass strategische Ernährungssicherung in Europa nicht vom Himmel fällt und schon gar keine Selbstverständlichkeit ist. Dafür muss der Green Deal mehr als dringend an die Gegebenheiten angepasst werden, damit es wirklich ein Green Deal für die Landwirtschaft wird.
Marcus Rothbart
Hauptgeschäftsführer des
Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e.V.
Blick ins Heft:
Das komplette Informationsheft finden Mitglieder in den kommenden Tagen in der Briefpost oder vorab im Mitgliederportal.