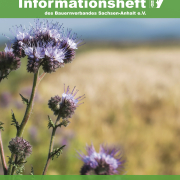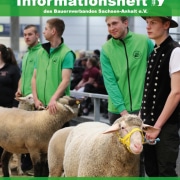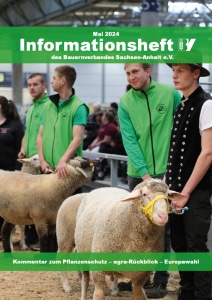Juli-Kommentar im Informationsheft des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e.V.
Werte Verbandsmitglieder,
liebe Bäuerinnen und Bauern,
auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus haben wir auf eine sehr arbeitsreiche Zeit zurückgeschaut. Das Ende der SUR und der Beginn der Proteste 2023, die Aktionen im Winter und das sehr wechselhafte Frühjahr, haben uns allen viel Energie und Zeit abverlangt. Joachim Rukwied dankte allen Mitgliedern und Mitarbeitern der Kreis- und Landesbauernverbände und des DBV. Gemeinsam haben wir erreicht, dass sich auf europäischer Ebene spürbar etwas bewegt hat! Auf Bundesebene ist das deutlich zäher, auch weil die Koalitionäre selber keine klare Linie haben.
Anders als der Deutsche Bauernverband. Die Kritik des Bauernverbandes am Schlingerkurs der Bundesregierung hat Präsident Rukwied in aller Deutlichkeit erneuert. Ich freue mich, dass Joachim Rukwied nochmal diese große Verantwortung auf sich nimmt und die Delegierten der Landesbauernverbände ihm ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Meine Gratulation auch an SLB-Präsident Torsten Krawczyk, er wurde zum DBV-Vizepräsidenten gewählt.
Die Bundesregierung meldete sich, nur einen Tag vor dem Bauerntag, überraschend mit einem „Entlastungspaket“ zu Wort. Dieses Entlastungs-„Päckchen“ ist jedoch absolut unzureichend. Es freut mich, dass der Großteil der Presse diese Nebelkerze als solche erkannt hat. Der Begriff „Bürokratieabbau“ wird häufig verwendet, ohne zu berücksichtigen, dass Bürokratie hauptsächlich durch gesetzliche Vorgaben entsteht. Ein effektiver Bürokratieabbau erfordert auch die ersatzlose Streichung unnötiger Vorgaben.
Der DBV und seine Landesbauernverbände haben einen Katalog grundlegender Forderungen zum Abbau bürokratischer Hindernisse erstellt und sich damit kurz nach den Bauernprotesten Anfang des Jahres an die Agrarminister von Bund und Ländern gewandt. Der DBV fordert die politischen Entscheidungsträger auf, eine ernsthafte und wirksame Initiative zum Bürokratieabbau zu starten und umzusetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Vonseiten der Agrarministerkonferenz wurde ein Katalog mit fast 200 Punkten erstellt, von denen nun nur ein kleiner Teil angegangen werden soll.
Die Bundesregierung ist gefordert, ihre eigenen Versprechen zum Bürokratieabbau umzusetzen und die vorgelegten Entbürokratisierungsvorschläge ernst zu nehmen, um die Zukunftsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft nicht weiter zu belasten. Es ist höchste Zeit, dass spürbare und konkrete Ergebnisse geliefert werden. Knapp drei Jahre, nachdem die Bundesregierung gewählt worden ist, kann sie sich nicht mehr darauf berufen, dass sie in ihren Möglichkeiten durch die vorangegangenen Regierungen begrenzt sei.
Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat Anfang des Jahres betont, er sehe ein Problem darin, dass in der Vergangenheit viele Versprechen an die Landwirte gemacht worden sind, die von der Politik nicht eingelöst wurden. Wenn das seine Überzeugung ist, ist es mir nicht erklärlich, warum vom BMEL der umfangreiche Abbau von Bürokratie und Erleichterungen für die Landwirtinnen und Landwirte versprochen werden, dann aber fast nichts passiert. Überarbeitungen der Regelungen für den Verlust von Ohrmarken oder beim Nachweis als aktiver Betriebsinhaber sind nicht der große Wurf, sondern überfällige Anpassungen an die Praxis. Die Tarifglättung wurde bereits von der Vorgänger-Regierung auf den Weg gebracht und steht in keinem Verhältnis zu den aktuellen Kürzungen an anderen Stellen. Die ungleich wichtigere Risikoausgleichsrücklage wird von der Ampel nicht aufgenommen.
Die zentralen Aufgaben, die vor der Landwirtschaft in Deutschland liegen, sind Zukunftsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Wir brauchen flexiblere Rahmenbedingungen und politische Perspektive. Auch die ganz praktischen Faktoren sind fundamental, wie ausreichend Wirkstoffe zum Schutz unserer Ernten, um im Ackerbau zukunftsfähig zu sein. Und während die Zahl der hungernden Menschen weltweit steigt, ebenso die Zahl der Menschen insgesamt, dürfen wir in Mitteleuropa nicht die Produktion künstlich herunterfahren.
Keine der zentralen Aufgaben der Landwirtschaft setzt eine überbordende Bürokratie voraus. Unsere Landwirtschaft kann Enormes leisten, wenn nicht für jeden Handgriff Vorgaben gemacht werden. Dieses Verständnis hat die Bundesregierung offenbar bis heute nicht erreicht.
Olaf Feuerborn
Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e.V.
Blick ins Heft
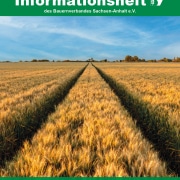
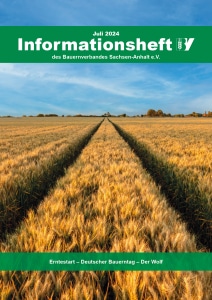




 lapping via pixabay
lapping via pixabay